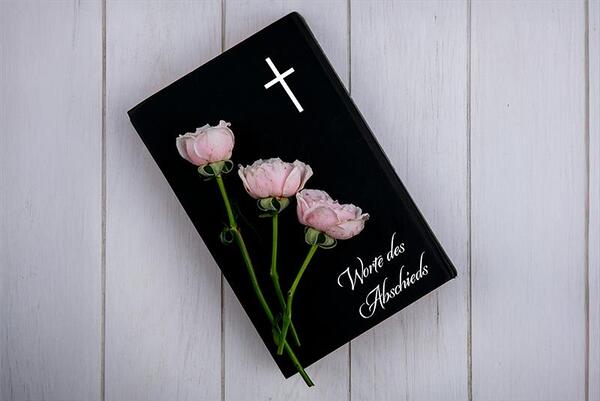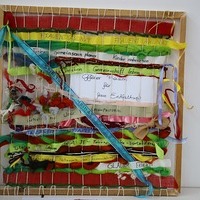„Niemals wieder": Gedenk- und Befreiungsfeier Mauthausen 2025
Die diesjährige Gedenk- und Befreiungsfeier, organisiert vom Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) in Zusammenarbeit mit dem Comité International de Mauthausen (CIM), war geprägt von einer beeindruckenden internationalen Beteiligung – über alle Altersgruppen. Das spanische Königspaar - König Felipe VI. mit Ehefrau Königin Letizia - gedachte im Rahmen der Internationalen Befreiungsfeiern den Opfern. Aber auch zahlreiche Jugendliche aus Österreich – darunter die Katholische Jungschar und die Katholische Jugend Oberösterreich -, aus anderen Ländern Europas sowie aus Übersee kamen nach Mauthausen, um gemeinsam mit KZ-Überlebenden und Zeitzeug:innen, internationalen und nationalen Delegationen und weiteren Gästen ein sichtbares Zeichen für Erinnerung und Verantwortung zu setzen.
Ihre Anwesenheit unterstrich das zentrale Anliegen des Mauthausen Komitees: die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten und die Botschaft „Gemeinsam für ein ,Niemals wieder!'" in die Zukunft zu tragen. Die Befreiungsfeier begann auch dieses Jahr mit der mehrsprachigen Verlesung des „Mauthausen-Schwurs".

König Felipe VI. von Spanien mit Ehefrau Königin Letizia, Innenminister Gerhard Karner, Kanzler Christian Stocker, Bundespräsident Alexander van der Bellen © Samuel Haijes
Das offizielle Österreich war vertreten durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Regierungsmitgliedern, allen voran Bundeskanzler Christian Stocker. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomals Stelzer war ebenso vertreten wie die Präsidentin der Republik Kosovo Vjosa Osmani, internationale Delegationen und Überlebende nahmen teil, ebenso wie tausende Jugendliche, die das Vermächtnis der Opfer weitertragen.

Auch die KZ-Überlebenden (v. l.) Hana Berger Moran, Mark Olsky und Eva Clarke, die vor 80 Jahren in den letzten Kriegstagen zur Welt kamen und nur wenig später aus dem KZ Mauthausen befreit wurden, nahmen gemeinsam mit Zeitzeugin Katja Sturm-Schnabl an der Befreiungsfeier teil. © Samuel Haijes
Die Moderation der Veranstaltung übernahmen erneut die Schauspielerinnen Konstanze Breitebner und Mercedes Echerer. Musikalisch wurde die Feier von der Militärkapelle Oberösterreich und der internationalen Band „Baba Yaga“ begleitet.
Starke internationale Jugendpräsenz
Zur diesjährigen Gedenk- und Befreieungsfeier waren auch tausende Jugendliche aus aller Welt gekommen, um sich aktiv daran zu beteiligen, unter anderem durch eine eigene Jugendgedenkfeier im ehemaligen Steinbruch und der symbolischen Kranzniederlegungen der vielen Jugenddelegationen am Ende des Gedenkzugs.

Die Delegationen der Katholischen Jugend OÖ und der Katholischen Jungschar OÖ bei der Kranzniederlegung © Samuel Haijes
Besonders eindrucksvoll gestaltete sich dabei der Jugendgedenkzug unter dem Thema „Ein Name. Ein Leben. Ein Band.“, getragen von der Katholischen Jugend OÖ, der Sozialistischen Jugend Oberösterreich und der Oberösterreichischen Gewerkschaftsjugend.
Hunderte Jugendliche begaben sich dabei auf einen bewussten Weg der Erinnerung – beginnend beim ehemaligen Steinbruch, einem Ort des Leidens und der Zwangsarbeit.
Bericht der Katholischen Jugend
Die starke internationale Jugendpräsenz machte einmal mehr deutlich, dass das Vermächtnis der Überlebenden auch von der jungen Generation entschlossen weitergetragen wird. Auch CIM-Präsident Guy Dockendorf und MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi erinnerten in ihren Reden daran, wie wichtig es sei, dass die nachfolgenden Generationen sich ihrer Verantwortung bewusst sind.
Bischof Scheuer: Gefahr, dass Gedenkfeiern zur Routine werden
Am traditionellen ökumenischen Gottesdienst in der KZ-Gedenkstätte nahmen neben Diözesanbischof Manfred Scheuer der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka und der griechisch-orthodoxe Bischofsvikar Ioannis Nikolitsis teil.

V. l.: der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka, Bischof Manfred Scheuer und der griechisch-orthodoxe Bischofsvikar Ioannis Nikolitsis © Samuel Haijes
Diözesanbischof Manfred Scheuer sieht die Gefahr, dass Gedenk- und Befreiungsfeiern trotz großer Versprechen im Sinne von „Niemals wieder!" zur Routine werden. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an das berühmte Wort von Papst Franziskus von der „Globalisierung der Gleichgültigkeit" uns warnte, dass eine „auf moralische Imperative reduzierte Gedenkkultur" immer weniger akzeptiert werde. „Eine leere Toleranz, eine hohle Liberalität, eine oberflächliche Gleichgültigkeit, eine narzisstische Achtlosigkeit ... all diese Fehlhaltungen sind Analphabeten in der Sprache der Empathie", so Scheuer. Ohne Berührung mit der Not und dem Elend, ohne die Erfahrung von Angesicht zu Angesicht mit den Leidenden komme es nicht zu einem tragfähigen „Gemeinsam".
Scheuer zitierte den wegen seiner kommunistischen Einstellung in Österreich lange Zeit abgelehnten Schriftsteller Bertolt Brecht: „Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer." Respekt, Toleranz, Freiheit, Gemeinwohl und Friede seien "keine Selbstläufer". Keine Person, keine Generation und auch keine Gesellschaft könne die dafür notwendigen Erziehungs- und Lernprozesse abkürzen oder überspringen, betonte der Bischof.
Und hielt mit den Worten von Elie Wiesel fest: Es gebe das Recht und sogar die Pflicht, „die junge Generation verantwortlich zu machen – nicht für die Vergangenheit, aber dafür, wie sie mit ihr umgeht, was sie mit den Erinnerungen tut, die ihr Erbteil sind". Sie sei verantwortlich zu machen für die Art und Weise, wie sie sich erinnert, so der amerikanisch-jüdische Schriftsteller und Holocaust-Überlebende.
Scheuer plädierte für eine "memoria passionis" (Lat. für Erinnerung an das Leiden), die sich verweigert, „sich damit abzufinden, dass die Toten in alle Ewigkeit tot bleiben, die Besiegten besiegt und die Durchgekommenen und Erfolgreichen in alle Ewigkeit oben bleiben".
„Gott wird um Verzeihung bitten müssen"
In einer Barackenwand im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen sei der bittere Satz eines damaligen Häftlings eingeritzt: „Wenn es einen Gott gibt, dann wird er bei mir um Verzeihung bitten müssen." Dazu Scheuer: Ein Christ, der bei seinem Glauben und seinem Beten bleiben wolle, werde großen Respekt vor jeder Entscheidung zur „praktizierten Gottlosigkeit" haben – diese aber auch nicht zum Maßstab für sein Verhalten machen. Der Gott Jesu Christi sei ein Gott, der sich vom Leid und Unrecht berühren lässt und Partei ergreift. Die Gräuel des Nationalsozialismus stellten – in Anlehnung an Gottes Frage an Adam/den Menschen nach dem Sündenfall auch Fragen an heutige Zeitgenossen: „Wo war der Mensch - und wo die Menschlichkeit –, als unseren Brüdern und Schwestern so Furchtbares zugefügt wurde?"
Eine kritische Anmerkung machte der Bischof zum Umstand, dass der Grundsatz der in grundlegenden Texten verankerten Menschenwürde meist nicht bestritten werde. „Und doch sind Umfang und Reichweite umstritten. Die Würde des Menschen wird praktisch oft auf schreckliche Weise verletzt, aber auch in der Theorie negiert." Explizit wandte sich Scheuer gegen jede Instrumentalisierung des Gedenkens an die Leidenden und die Toten. Es wäre „fatal, wenn die Toten im Besitz der Lebenden für neue Machtkämpfe und Kriege herhalten müssen, wie es auf dem Balkan oder in der Ukraine überaus leidvoll der Fall war und ist".
Link zur Bildergalerie
© Samuel Haijes, MKÖ/Alissar Najjar