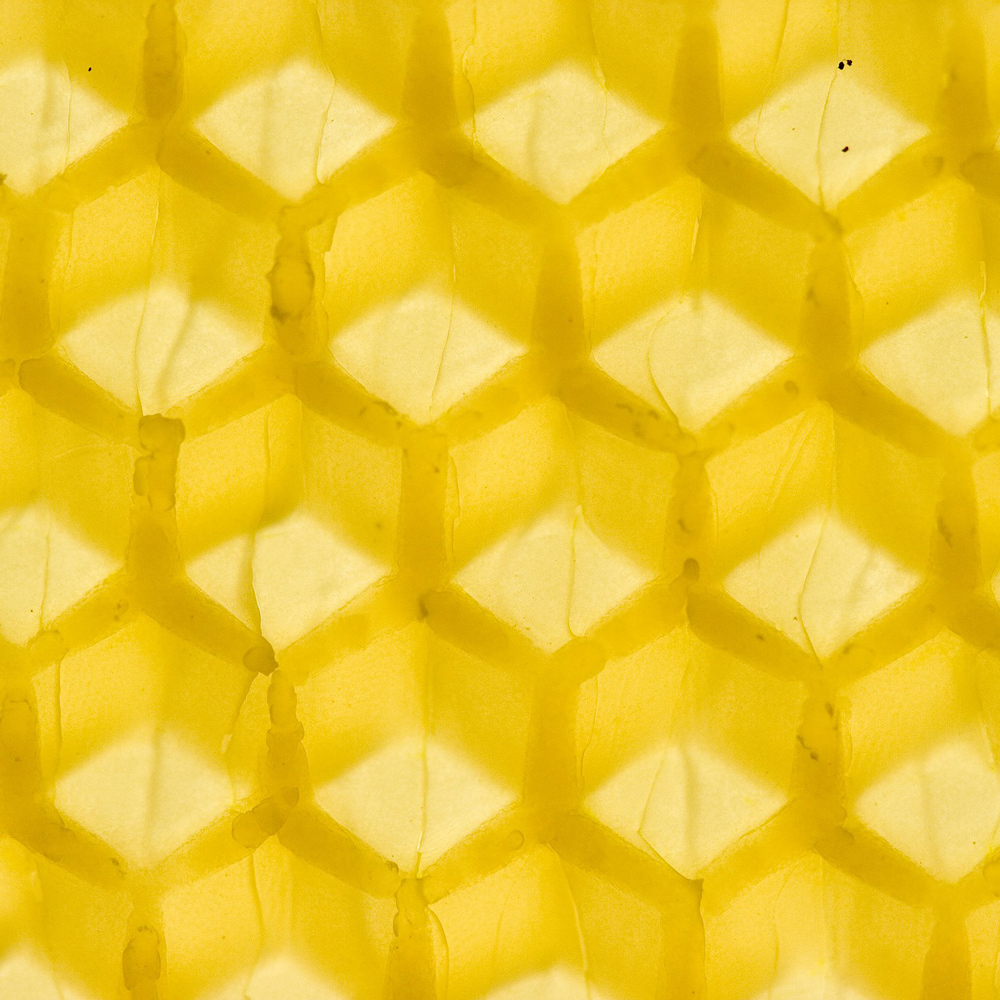Geschichte

Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Dominikanerhaus Steyr?
1472 riefen die Steyrer Bürger gegen die allzu große Abhängigkeit vom Kloster Garsten, das die Stadtpfarre betreute, mit Einwilligung des Kaisers Friedrich III den Predigerorden aus Krems nach Steyr. Trotz Widerstand des Abtes von Garsten, Berthold VI, entschied Papst Sixtus IV zugunsten der Dominikaner.
1472 bis 1478 wurden Kirche und Kloster gebaut und die Kirche 1478 zu Ehren der „Verkündigung Mariens“ geweiht. 1522 brannte der spätgotische Bau nieder und wegen der Reformation verließen die Dominikaner Steyr.
1559 wurde das Klostergebäude wieder aufgebaut und darin eine protestantische Lateinschule untergebracht. 1572 zerstörte das größte Hochwasser, das Steyr je erlebte, den Trakt an der Enns. 1624 wurden im Zuge der Gegenreformation die Kirche und 1625 das Kloster an den Dominikanerorden zurückgegeben.
1642 bis 1647 erhielt die Dominikanerkirche ihr barockes Aussehen. 1785 wurde unter Josef II das Kloster aufgehoben und das Klostergebäude wurde von den Textilfabrikanten Daniel Pellet und Anton Schaitter um 6.600 Gulden erworben. In der Kirche, die während der Koalitionskriege (1800, 1805, 1809) vorübergehend sogar als Heustadel benutzt wurde, versahen Weltpriester den Gottesdienst.
1865 übergab Bischof Franz Josef Rudigier die ehemalige Dominikanerkirche mit den dahinter liegenden Chorgebetsräumen den Jesuiten, die hier ein Missionshaus errichteten mit Wohnungen für die Patres. 1911 wurde es Jesuitenresidenz.
Die Bevölkerung von Steyr schätzte die Marienkirche auf Grund vieler guter Prediger und vor allem als Beichtkirche. In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg bis 1970 betrieben die Jesuiten unter schwierigsten räumlichen Bedingungen (es gab nur durch die Kirche einen Zugang zu den Jugendräumen) eine überaus erfolgreiche und fruchtbare Jugendpastoral durch das katholische Studentenwerk und die Marianische Kongregation.
1971 schrieb P. Provinzial Johann Pilz an den Diözesanbischof Dr. Franz Sal. Zauner, dass der Orden nicht mehr in der Lage ist, die Jesuitenresidenz in Steyr wie bisher weiterzuführen.
Drei Patres könnten für die Aufrechterhaltung des Gottesdienstes und die von der Bevölkerung so geschätzte Beichtpastoral an der Marienkirche bleiben, jedoch die Wohnungen hinter der Marienkirche müssten saniert werden, vor allem müsste ein eigener Eingang geschaffen werden.
Nach längeren Verhandlungen der DFK mit der Eigentümerin des ehemaligen Klostergebäudes, Aurelia Dorn, wurde das „Dornhaus“ 1974 von der Diözese Linz gekauft und ins Eigentum der Stadtpfarre übertragen, da diese das ehemalige Refektorium, das bis zum Schluss als Lagerhalle der Eisenhandlung Waltl diente, als Pfarrsaal nutzen konnten und somit ein Neubau nicht notwendig war.
Wie kam es zum Dominikanerhaus Steyr?
Zunächst war die Sorge um das Verbleiben der Jesuiten in Steyr. Die bisherige Jugendarbeit wurde aufgegeben, aber in einer Besprechung zwischen Diözese, Dekanat und Stadtpfarre im bischöflichen Ordinariat wurde der Verbleib von drei älteren Patres für die Gottesdienste, Predigt und Beichtseelsorge an der Marienkirche und deren Verwaltung zugesagt. Bei einem Lokalaugenschein der DFK betreffend die Adaptierung der Wohnungen für ältere Patres wurde auch ein eigener Eingang zu den Patreswohnungen erwogen.
Bisher gab es nur einen Zugang durch die Kirche. Aber die Besitzerin des ehemaligen Klostergebäudes neben der Marienkirche Frau Aurelia Dorn legte sich quer. Aber auf einmal, am 19. Juni 1972 erklärte Frau Dorn: „Die Kirche kann das ganze Haus kaufen.“ Bei der Besichtigung des Hauses durch die DFK meinte Dombaumeister Architekt Nobl, als er das ehemalige Refektorium des Klosters, den Lagerraum der Eisenhandlung Waltl, sah, das wäre der ideale Pfarrsaal für die Stadtpfarre. Da sich der erste Stock für die Unterbringung der Kirchenbeitragsstelle anbot, nachdem die Räume in der Berggasse zu eng wurden, bekundete die Diözese ihr Interesse für den Ankauf des „Dornhauses“.
1973 wurde der Vertrag zwischen Diözese und Jesuitenprovinz abgeschlossen. 1974 gab es eine Reihe von Besprechungen zwischen DFK, Dekanat, Stadtpfarre und Jesuiten über eine eventuelle Nutzung des Hauses. Im November 1974 wurde das „Dornhaus“ um S 3.750.000,- von der Diözese gekauft und ins Eigentum der Stadtpfarre übertragen. Schon damals kam mir der Gedanke eines „Hauses der Frau“ in Steyr, weil die KFB eine überaus aktive Trägergruppe wäre. Herr Dr. Helmut Renöckl plädierte für ein regionales Bildungszentrum. Im Dezember 1976 lud die diözesane Arbeitsgemeinschaft für kath.Erwachsenenbildung (DAKEB) unter Federführung von Dipl.-Ing. Hanns Frechinger zu einer ersten Besprechung für ein regionales Bildungszentrum ein.
1978 wurde der Saal und die Nebenräume von der Fa. Waltl geräumt. Im Jänner 1979 wurde ein Baukomitee gegründet.
Die Adaptierung des Hauses ging zügig voran. Im Oktober 1979 wurde das „Dominikanerhausgremium“ (DAKEB, KBW, Stadtpfarre, Dekanat, KFB und Jesuiten) beschlossen und im Jänner 1980 vom Bischof bestätigt. Am 8. Dezember 1980 wurde der Saal feierlich gesegnet und die Bibliothek und das DOMINIKANERHAUS eröffnet.
(Ernst Pimingstorfer, Altdechant, Leiter des Dominikanerhausgremiums 1980–2000)